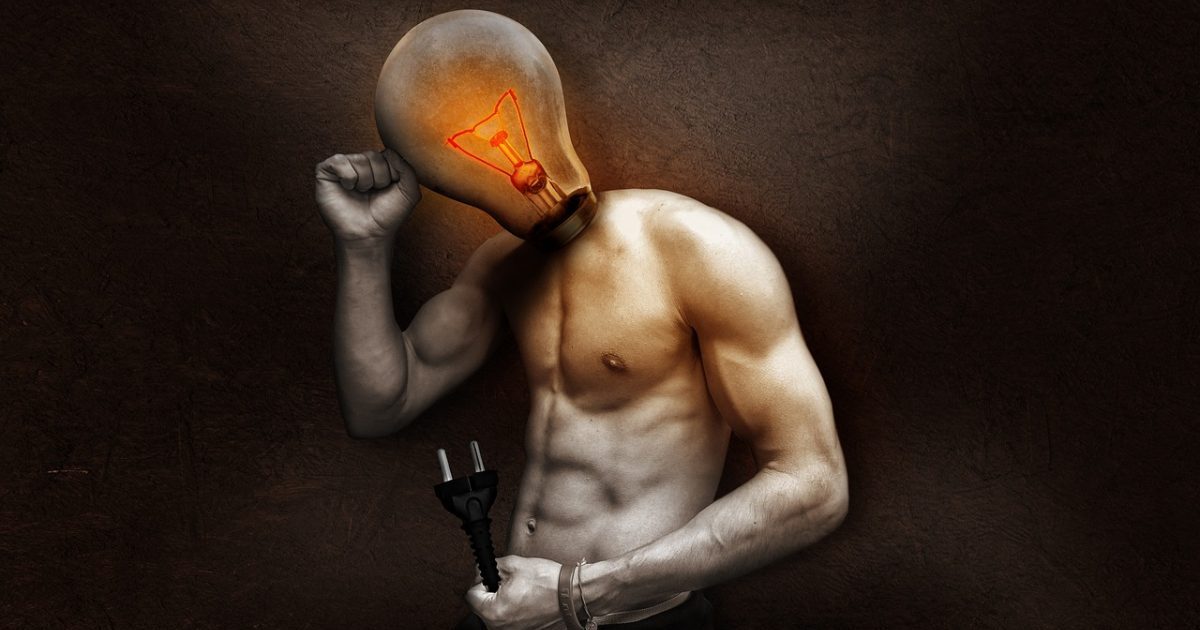 Autor: Kurt O. Wörl
Autor: Kurt O. Wörl
Denken ist einfach – bis der Verstand mitredet. Zwischen logischen Fehltritten, philosophischen Umwegen und charmanten Fehlwahrnehmungen zeigt dieser Text: Realität ist das, was wir daraus machen. Und manchmal auch nur das, was wir uns einreden.
Eines Abends saß ich im Sessel und dachte über das Denken nach. Jedenfalls glaube ich, dass ich dachte. Oder war das schon der Verstand? Und wenn ja – wer hat damit angefangen? – Man sagt ja, dass Denken eine der letzten Tätigkeiten ist, die man ganz ohne Stromanschluss verrichten kann. Wobei – so sicher bin ich mir da nicht, wenn ich mich an meinen letzten Versuch erinnere, beim Kabelsalat unterm Schreibtisch logisch vorzugehen.
Wie dem auch sei: Ich saß also da und grübelte über das Denken. „Ja, denke ich denn überhaupt?“ fragte ich mich. Und wenn ja, wie genau geht das? Ist Denken wie Spazierengehen, nur ohne Bewegung? Oder wie Fernsehen ohne Gerät? Und falls ja – wo bleibt eigentlich die Fernbedienung?
Der alte Lehrerspruch fiel mir ein: „Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken von Gedanken ist gedankenloses Denken.“ Wenn das stimmt, bin ich wahrscheinlich ein olympischer Meister im gedankenlosen Denken.
Lexikon-Enttäuschungen
Weil ich Klarheit wollte, griff ich zu einem Lexikon. Großfehler! Das eine enthielt „Denken“ gar nicht erst, vermutlich weil der Herausgeber davon ausging, dass seine Leser gar nicht erst damit beginnen würden. Das andere erklärte es so kompliziert, dass ich nach der Hälfte des Satzes nur noch ans Mittagessen denken konnte: „Fähigkeit des Verstandes, Gegenstände und Beziehungen zwischen ihnen aufzufassen…“ – Aha. Mein Verstand fasst also Gegenstände auf – meist meine Brille, wenn ich sie mal wieder verlegt habe.
Spannender waren die Aphorismen großer Geister. Oscar Wilde etwa meinte: „Wer nicht auf seine Weise denkt, denkt überhaupt nicht.“ Das klingt ein bisschen wie die Ausrede meines Nachbarn, warum er seine Steuererklärung auf Bierdeckeln einreicht und Friedrich Merz dafür verantwortlich macht.
Schriftsteller Joachim Fernau behauptete: „Wer glücklich ist, fühlt, wer unglücklich ist, denkt.“ Das erklärt, warum manche Leute den ganzen Tag grimmig gucken: Sie sind einfach in einem Dauerdenkmarathon.
Und Goethe setzte noch eins drauf: „Denken ist interessanter als Wissen, aber nicht interessanter als anschau’n.“ Das könnte die erste Rechtfertigung für sinnloses Gaffen sein.
Mein Favorit ist die Erklärung des US-Journalisten Edward R. Murrow, der auf den Punkt brachte: „Viele Leute glauben sie denken, während sie in Wahrheit nur ihre Vorurteile umschaufeln.“
Denken als Überlebensstrategie
Meine vorläufige Theorie: Wir denken, weil wir sonst in der Natur keine Chance hätten. Wir sind langsam (zumindest nach einer gewissen Anzahl an Geburtstagen) und uns fehlt ein Fell. Denken ist unser Ersatz für die Krallen und Reißzähne von Raubtieren und die schnellen Fluchtorgane von Gazellen. Allerdings gibt es da einen natürlichen Gegenspieler: den Verstand. Der ist so etwas wie der TÜV für Gedanken – und so streng, dass manchmal kein Gedanke mehr durchkommt.
Doch bevor ich zu diesem Biest komme, musste ich erst klären, ob wir überhaupt die „objektive Wirklichkeit“ wahrnehmen können.
Objektive Wirklichkeit – ein Mythos auf zwei Beinen
Denken hat bekanntlich viel mit Wahrnehmen zu tun. Nur – nehmen wir wirklich wahr, was da draußen ist? Oder nur das, was unser Gehirn aus der Rohware zusammenbröselt wie ein Pizzabäcker aus Teig und Belag?
Ich habe fast 40 Jahre in einem Beruf gearbeitet, bei dem es oft um die Wiedergabe von Wahrnehmungen ging – genauer um „die Wahrheit“. Schon nach wenigen Monaten kam ich zu dem Schluss: „Objektive Wahrheit“ gibt es ungefähr so oft wie fehlerfreie Bedienungsanleitungen. Jeder Mensch hat seine eigene Version der Realität. Und manche sind sogar stolz darauf.
Besonders ans Herz gewachsen sind mir dabei die „Nichtzeugen“. Das sind Leute, die bei einem Verkehrsunfall gar nicht dabei waren, aber trotzdem ganz genau erzählen können, wie es passierte – und zwar so detailreich, dass man meinen könnte, sie hätten Regie geführt.„Der rote Wagen kam von links, der blaue von rechts, dann Bremsspur, Kollision, und der Fahrer griff sich ans Knie“, sagen sie. Später stellt sich heraus: Sie kamen erst fünf Minuten nach dem Crash vorbei, aber die Fahrzeuge standen schon so dekorativ im Graben, dass ihr Verstand den Film rückwärts abgespielt hat.
Wenn man sie dann mit dieser Tatsache konfrontiert, sagen sie: „Ja, aber logisch betrachtet kann es ja gar nicht anders gewesen sein.“ – Da ist er wieder – der Verstand! Dieser innere Drehbuchautor, der jede freie Lücke mit „plausiblen“ Erklärungen auffüllt. Leider hat er die Eigenart, statt Wahrheit lieber spannende Geschichten zu liefern.
Kinder als Wahrnehmungsprofis
Im Gegensatz dazu sind Vorschulkinder erstaunlich zuverlässige Zeugen. Warum? Weil sie noch keine Lebenserfahrung haben, die ihnen ins Ohr flüstert: „So muss es gewesen sein!“ Sie sagen einfach, was sie gesehen haben – manchmal so brutal ehrlich, dass die Erwachsenen am liebsten im Boden versinken würden. Etwa so:
Als die Erbtante zu Besuch kam, begrüßte sie die 5jährige Erna freudig mit einem Bündel Gras und überreichte es der Tante. „Hach, Erna-Schätzchen, was soll ich denn mit dem Gras?“ frug die Tante. „Reinbeißen“ antwortete die Kleine erwartungsvoll und setzte nach „Papa hat gesagt, wenn Du ins Gras beißt, dann werden wir reich.“
Zurück zum Unfall. Ein Fünfjähriger würde also sagen: „Da lag ein Auto im Graben, und der Mann hatte ein Aua.“ Kein Roman, keine Dramaturgie – nur die nackte Wahrnehmung.
Erwachsene dagegen haben einen eingebauten „Kommentar-Modus“. Sie sehen etwas und rufen sofort ihren Verstand an, der einordnet, bewertet und bei Bedarf noch ein bisschen Würze hinzufügt. Leider schmeckt das Ergebnis oft nach Seifenoper.
Wenn kein Mensch im Wald ist
Das führt uns zur großen philosophischen Frage: Fällt ein entwurzelter Baum im Wald wirklich um, wenn niemand da ist, um es zu hören? Die Physiker sagen: „Natürlich, die Schallwellen sind doch da!“ Die Philosophen sagen: „Vielleicht, vielleicht auch nicht.“ – Und ich sage: „Das ist völlig bedeutungslos, ob der Baum umfällt oder nicht.“
Fakt ist: Ohne ein Ohr, das die Luftbewegungen des Schalls in Nervenimpulse umsetzt, gibt es für uns kein Geräusch. Die Schallwellen schubsen dann höchstens ein paar Blätter durch die Gegend – aber ein Drama ist das nur, wenn jemand es bemerkt oder ihm der Baum gar in den Nacken fällt. Kurz gesagt: Wirklichkeit ohne Wahrnehmung wird nie zur Realität. Ohne Wahrnehmung ist sie wie ein Theaterstück ohne Publikum. Mag sein, dass es trotzdem gespielt wird, aber keiner kann danach mitreden.
Realität auf Bestellung – jetzt mit Fernrohr
Früher war die Welt übersichtlich. Die Sonne ging morgens auf, abends unter, und zwischendurch konnte man sich mit der wichtigen Frage beschäftigen, ob man genug Holz für den Winter hat. Dann kam jemand auf die Idee, ein Fernrohr zu erfinden. – Und zack – plötzlich umkreisten nicht mehr Sonne, Mond und Sterne die Erde, sondern wir umkreisten die Sonne.
Das war ein Schock, vor allem für die Kirche, die ihr Publikum jahrhundertelang mit dem geozentrischen Modell unterhalten hatte. Das Faszinierende daran: Vor der Erfindung des Fernrohrs war diese „neue“ Realität gar nicht existent – zumindest nicht in den Köpfen der Menschen. Die Planeten taten zwar schon vorher, was Planeten eben so tun, aber es war schlicht bedeutungslos, weil niemand es wusste. – Wahrheit ist also manchmal wie ein bestelltes Paket: Es existiert erst, wenn es zugestellt wird.
Planeten aus Papier
Noch besser wird es bei der Entdeckung des Pluto. Der wurde nicht gefunden, indem ein Astronom zufällig durchs Fernrohr stolperte und rief: „Ui, ein Neuer!“ Nein, der wurde erst einmal mathematisch herbeigerechnet. Ein bisschen so, wie wenn Sie sich einen Lottogewinn ausrechnen, bevor Sie den Schein abgegeben haben. – Erst später hat man Pluto fotografiert – und selbst da konnte man sich nicht lange einig sein, ob er überhaupt ein Planet ist. Heute ist er ein „Kleinplanet“. Was ihm vermutlich egal ist, aber sein Ego sicher kratzt.
Das zeigt: Realität ist erstaunlich flexibel. Heute noch der stolze letzte Planet unseres Sonnensystems, morgen schon der unscheinbare Vertreter einer neuen Liga. Wirklich ist eben nur, was wirklich wirkt – und wenn ein Gremium von Astronomen sagt, es wirkt nicht mehr, dann war’s das mit der Planetenehre.
Die Medien als Realitätsschmiede
Auch Nachrichten funktionieren nach diesem Prinzip. Früher hörte man vom Krieg in fernen Ländern manchmal gar nichts – und wenn, dann erst Monate später von einem reisenden Händler, der es wiederum aus dritter Hand hatte. Heute gibt’s Livestreams von jedem Krisenherd. Das Ergebnis: Plötzlich ist alles Teil unserer „Realität“. Ob Eisberge schmelzen, Eisbärenbabys geboren werden oder ein Politiker beim Buffet einschläft – es wird wahr, weil wir es sehen, hören und kommentieren können.
Ohne Wahrnehmung gibt es keine Realität von Bedeutung. Das Universum muss also geradezu gezwungen gewesen sein, Wesen wie uns hervorzubringen, damit es überhaupt jemandem auffällt, dass es existiert. Der Kosmos könnte uns dafür eigentlich mal einen Blumenstrauß schicken.
Denken mit dem ganzen Menschen
Fragt man den Durchschnittsbürger, wo das Denken stattfindet, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Na, im Kopf natürlich!“ Das stimmt – ungefähr so wie „Essen findet in der Küche statt“. Theoretisch ja, praktisch aber auch im Wohnzimmer, im Auto oder nachts verstohlen am Kühlschrank.
Unser Körper denkt nämlich munter mit. Das Immunsystem zum Beispiel merkt sofort, wenn sich ein Virus breitmachen will, und reagiert ohne Rücksprache mit dem Gehirn. Es hat nicht einmal die Anstandspflicht, vorher höflich zu fragen: „Hättest du etwas dagegen, wenn ich mal kurz Fieber mache?“ Andersherum löst unser Kopfkino auch jede Menge Körperreaktionen aus: Sie sehen jemanden, der Ihr Herz höherschlagen lässt – und schwupps, läuft Ihr vegetatives Nervensystem zur Höchstform auf: Puls hoch, Gesicht rot, Hände schwitzig. Und all das, ohne dass Sie den Vorgang formvollendet in einer PowerPoint-Präsentation durchdenken müssten. Und manchmal richten sich andere Körperregionen auf, ohne unseren Verstand auch nur um Erlaubnis zu fragen.
Bewegungen ohne Hirn – im besten Sinne
Manchmal ist der Kopf sogar hinderlich. – Ein geübter Klavierspieler denkt nicht mehr darüber nach, welche Taste er wann drückt. Würde er das tun, käme er vermutlich bei „Hänschen klein“ schon ins Stolpern. Nein, seine Finger spielen wie von selbst, ohne dass auch nur ein Gedanke vom Hirn in die Fingerkuppen flösse. Dasselbe beim Radfahren: Hat man es einmal gelernt, fährt der Körper von allein – während der Kopf längst in Gedanken beim Biergarten ist. – Manchmal versinke ich bei langen Autofahrten in tiefe Gedanken und frage mich nachher, wer hat eigentlich die Karre die ganze Zeit gesteuert und dabei sogar ohne Probleme Überholmanöver ausgeführt?
Sportler kennen das Phänomen. Sie nennen es „den Kopf ausschalten“ – nicht zu verwechseln mit dem Zustand beim Nachmittagsschläfchen vor laufendem Fernseher. Gemeint ist: Den Körper machen lassen, während das Gehirn einfach nicht dazwischenfunkt.
Jeder Versuch, mitten im Tennismatch über die richtige Haltung des Ellbogens nachzudenken, endet in einem Ball, der im Nachbargarten verschwindet.
Alles ist Geist – sagt der Wissenschaftler
Der Neurobiologe Franz Mechsner drückt es so aus: „Alles ist Geist! Wir leben in einem Körper-Welt-System…“ Das klingt ein bisschen nach Esoterikladen, ist aber ernst gemeint. Zwischen Körper, Geist und Umwelt gibt es keine scharfen Grenzen. Das erklärt, warum ein Leistungssportler bei tosendem Publikum oft besser funktioniert – sein „Denkkörper“ holt sich die Energie direkt aus der Umgebung. Mit anderen Worten: Denken ist keine Kopfmonarchie. Es ist eine föderale Republik, bei der der Magen, die Muskeln und manchmal sogar der kleine Zeh mitregieren.
Der Verstand – unser innerer Sicherheitsbeamter
Der Verstand ist nicht das Denken. Das Denken ist kreativ, erfinderisch, offen wie ein neugieriger Hund, der an jeder Ecke schnüffelt. Der Verstand hingegen ist der Hausmeister des Kopfes: misstrauisch, kontrollsüchtig und ständig darauf bedacht, dass bloß nichts Neues reinkommt, was Unordnung machen könnte.
Er ist eine Überlebensmaschine, spezialisiert auf Bewertungen: gut oder schlecht, gefährlich oder sicher, rot oder grün. Eigentlich ganz praktisch – wenn er nicht immer glauben würde, dass er recht hat. Die Sufisten nannten den Verstand deshalb Satan. Und ehrlich gesagt: Wenn man sich anschaut, wie er manchmal mit unseren Gedanken umspringt, ist der Vergleich nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Meinungen als Hochsicherheitsgefängnis
Wer sich zu sehr mit seinem Verstand identifiziert, lebt in einem Meinungsbunker. Der Verstand liebt Altbewährtes, weil er weiß, wie es funktioniert. Neues ist ihm suspekt. Deshalb kritisieren Menschen so gern andere – das gibt ihnen das Gefühl, selbst im Recht zu sein. Das Problem: So kommen wir aus der gedanklichen Höhlenwahrnehmung nicht heraus.
Platon hat das schon vor über zweitausend Jahren in einer berühmten Parabel, dem Höhlengleichnis, beschrieben: Menschen, die nur Schatten kennen, halten sie für die ganze Wahrheit. Kommt einer mit einer anderen Geschichte zurück, wird er für verrückt erklärt. Der Verstand sagt dann: „Kann nicht sein, gab’s noch nie, will ich nicht hören.“
Die Mag-Sein-Philosophie
Manchmal hilft es, einfach mal kein Urteil zu fällen.
Eine alte chinesische Parabel erzählt von einem Bauern, dessen Pferd wegläuft. Die Nachbarn jammern: „Welch Unglück für Dich!“ – Der Bauer sagt nur: „Mag sein.“
Am nächsten Tag kommt das Pferd zurück – mit einem wilden Fohlen, das sich ihm angeschlossen hat. Die Nachbarn jubeln: „Welch Glück, jetzt hast Du zwei Pferde!“ – Der Bauer: „Mag sein.“
Dann bricht sich der Sohn beim Zureiten des Wildfohlens ein Bein – „Welch Unglück!“ bedauern die Nachbarn – „Mag sein.“ sagt der Bauer.
Kurz darauf bricht Krieg aus, alle jungen Männer werden eingezogen – nur der Sohn, weil fußlahm, bleibt verschont. „Welch Glück für Deinen Sohn und Dich!“ beglückwünschen ihn die Nachbarn. – Der Bauer: „Mag sein.“
Das ist angewandte Verstandeskritik: Statt sofort in gut und schlecht zu sortieren, einfach mal abwarten. Vielleicht ist das Drama von heute die Pointe von morgen. – Der Volksmund kennt den Spruch „Dumm gelaufen, aber wer weiß, wofür es gut war?“
Wir erschaffen unsere Wirklichkeit
Der Verstand liebt es, Beweise für das zu sammeln, was er ohnehin schon glaubt. Halten wir die Welt für einen gefährlichen Ort, wird er uns jede Schlagzeile liefern, die das bestätigt. Halten wir Menschen für grundsätzlich fies, wird er uns jede unfreundliche Geste präsentieren wie ein Souvenirjäger seine Fundstücke. – Selektive Wahrnehmung nennt das der Fachmann.
Das Schöne daran: Wir können den Verstand auch umprogrammieren. Statt „Jetzt bin ich aber sauer!“ könnten wir auch sagen: „Das ist jetzt aber eine Herausforderung!“ Statt „Das macht mich krank“ auch „Wie interessant!“ Der Verstand fängt dann brav an, die passenden Fakten zu suchen – und plötzlich sieht die Welt ein bisschen freundlicher aus.
Subjektive Realität – mit Bedienungsanleitung
Ich finde es faszinierend, dass die Wirklichkeit nichts Festes ist. Sie ist wie ein Bühnenbild, das wir selbst entwerfen – mal romantisch, mal düster, mal absurd. Meistens merken wir nicht einmal, dass wir selbst den Pinsel in der Hand halten. Und manchmal hat der Verstand den Pinsel geklaut und malt uns eine Kulisse, die wir gar nicht bestellt haben.
Aber: Wir sind nicht der Verstand. Wir sind der Beobachter, der sehen kann, wie der Verstand arbeitet – und ihm notfalls den Pinsel wieder wegnehmen kann. Das allein gibt uns schon ein Stück Freiheit.
Der letzte Gedanke
Am Ende bleibt mir nur, den inneren Hausmeister höflich zu behandeln, ihn aber nicht die ganze Hausordnung diktieren zu lassen. Denn wenn der Verstand alles kontrolliert, wird das Leben zu einem Sicherheitsprotokoll ohne Abenteuer. Und mal ehrlich: Wer will schon nur in einer Welt leben, in der jeder Baum nur umfallen darf, wenn vorher ein Antrag in dreifacher Ausfertigung vorliegt?
Also: Denken ja, Verstand auch – aber bitte in Maßen – und im Zweifel besser auf das Bauchgefühl hören, das irrt selten, weil’s der Verstand nicht kontrollieren kann.
Plauderei zum Thema











